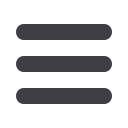
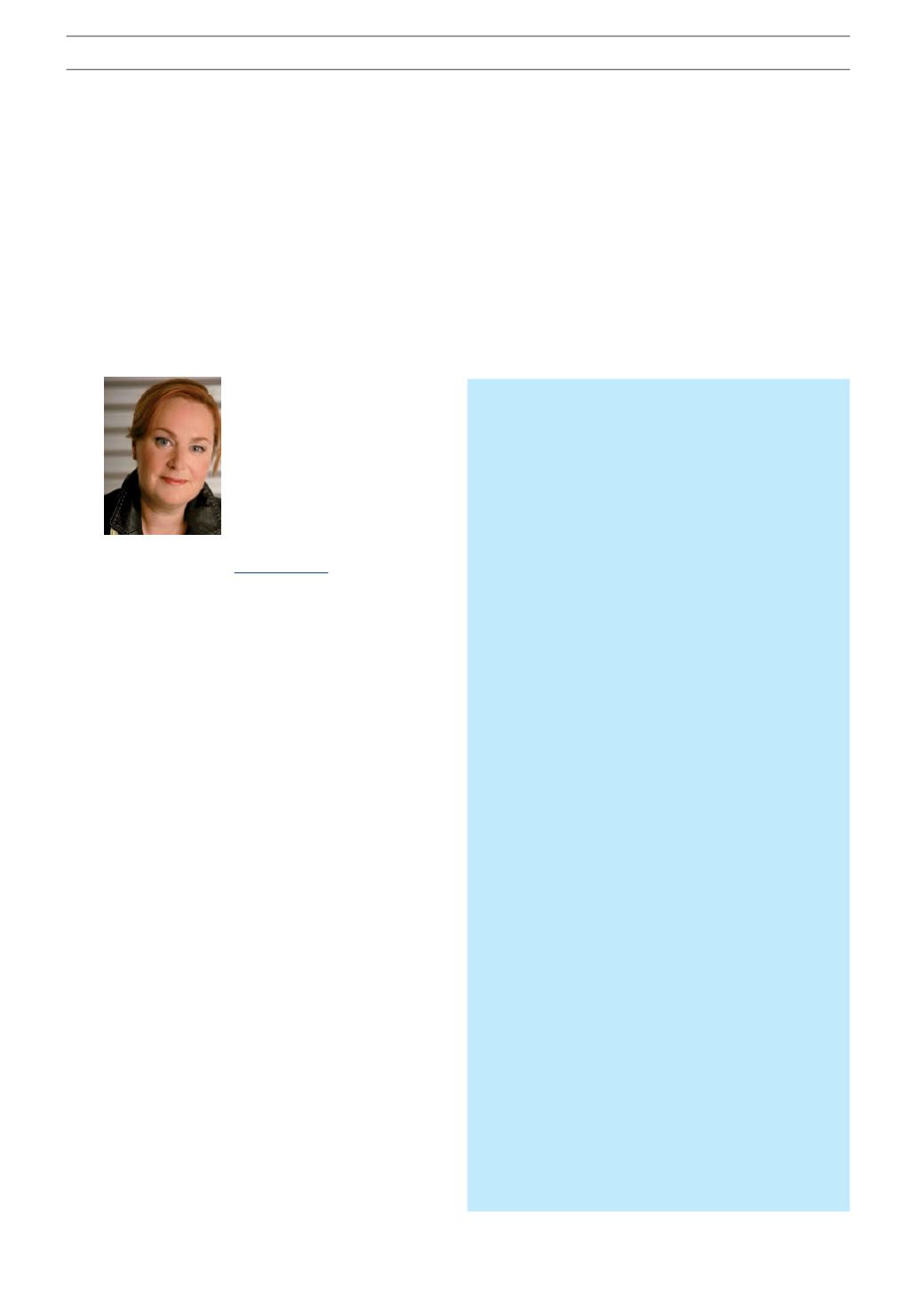
ÆRZTE
Steiermark
|| 01|2017
19
ETHIK
Kommission
≠
Komitee
Die Ethikkommission der
Meduni Graz prüft geplante
Forschungsprojekte wie kli-
nische Tests von Arznei-
mitteln sowie die Anwen-
dung neuer medizinischer
Methoden auf ihre ethische
Unbedenklichkeit. Sie ist
aufgrund einer Vereinba-
rung mit der KAGes sowohl
für das LKH-Universitäts-
klinikum Graz als auch für
alle anderen LKH der Stei-
ermark zuständig.
Davon zu unterscheiden
ist das Ethikkomitee des
Uniklinikums, ein maxi-
mal 14-köpfiges interdis-
ziplinäres Team, das in
konkreten schwierigen Ein-
zelsituationen am Kran-
kenbett die Behandelnden
berät, welche weitere Vorge-
hensweise ethisch vertret-
bar sein könnte. Das Komi-
tee versucht dabei, den Wil-
len des Patienten – so er ihn
nicht mehr selbst äußern
kann – zu rekonstruieren.
Angefordert werden kann
das Ethikkomitee von den
Behandlern, aber auch von
den Betroffenen oder deren
Angehörigen. Im Schnitt
tagt es jährlich um die 30
Mal, womit sich die Anzahl
der Konsile im Vergleich
zum Start des Komitees
verdoppelt hat. Deutlich
häufiger noch fragen be-
handelnde ÄrztInnen tele-
fonisch um Rat, wobei viele
Probleme bereits in diesem
Erstgespräch gelöst werden
können.
Mitglieder des Komitees am
Grazer Klinikum sind Ärz-
tInnen, Mitarbeitende der
Pflege, ein Jurist, ein Moral-
theologe, PsychologInnen
oder PsychotherapeutInnen
und eine auf Ethik speziali-
sierte Philosophin.
Das Komitee ist der ärzt-
lichen Direktion nicht wei-
sungsgebunden unterstellt.
Zur Zeit seiner Gründung
vor zehn Jahren war das
Grazer Ethikkomitee in Ös-
terreich das erste an einem
Universitätsklinikum; in
konfessionellen Kranken-
häusern wie bei den Barm-
herzigen Brüdern gab es
bereits vereinzelt derartige
Gruppen.
Ursprünglich stammt die
Idee aus dem angelsäch-
sischen Raum. Laut Aus-
kunft der KAGes verfügt
mittlerweile jedes KAGes-
Spital über einen interdis-
ziplinären Ethikbeirat oder
ist dabei, einen zu instal-
lieren.
„Mit zunehmenden
medizinischen
Möglichkeiten wird
sich die Frage nach
der Sinnhaftigkeit des
Machbaren immer
häufiger stellen.“
Sonja Fruhwald
Bereich der Ärztefortbildung.
Der Grundgedanke dahin-
ter: Wer mögliche ethische
Fragestellungen bereits vorab
durchdacht hat, handelt in
der konkreten Situation mög-
licherweise von vornherein
anders oder holt sich rechtzei-
tig Hilfe.
„Unser Ziel ist es, dass Medi-
zin nach den folgenden vier
ethischen Grundprinzipien
praktiziert wird: Respekt vor
der Autonomie des Men-
schen, wohltun, nicht schaden
und Gerechtigkeit schaffen“,
erklärt Tritthart.
Nicht immer zeigt sich ein-
deutig, wie diese Prinzipien im
Einzelfall konkret auszulegen
sind. „Auch nach zehn Jahren
intensiven Nachdenkens und
konstruktiver Diskussionen
gelangen wir immer wieder
einmal an unsere Grenzen“,
resümiert Tritthart. „Wir ha-
ben noch nicht ausgelernt.“
Zwischen Möglichkeit
und Sinnhaftigkeit
Ein Auslernen im endgültigen
Sinn wird es wohl nie geben,
denn mit den rasanten Ent-
wicklungen in der Medizin
verändern sich naturgemäß
auch die Fragestellungen, die
an das Ethikkomitee heran-
getragen werden.
„Mit zunehmenden medizi-
nischen Möglichkeiten wird
sich die Frage nach der Sinn-
haftigkeit des Machbaren
immer häufiger stellen“, pro-
gnostiziert Sonja Fruhwald.
Manchen PatientInnen kann
durch die erweiterten tech-
nischen Möglichkeiten auf
lange Sicht geholfen werden;
viele andere werden – sollten
wirklich alle medizinischen
Optionen ausgeschöpft wer-
den – lediglich zu chronisch
kritisch kranken Pflegefällen.
Link zum Thema: http://
othes.univie.ac.at/10764/Fotos: Furgler, Meduni Graz
















