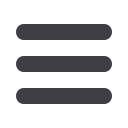
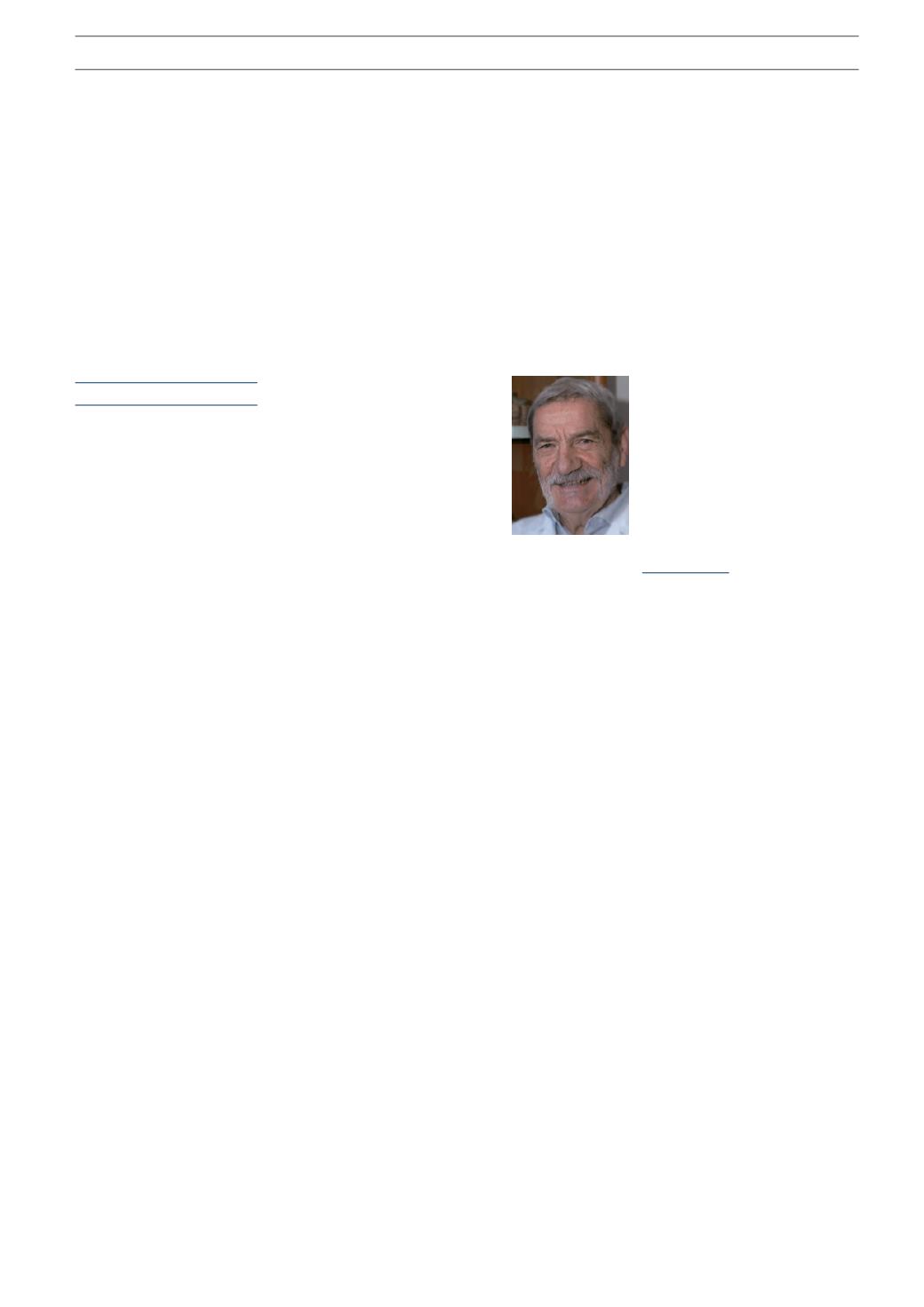
18
ÆRZTE
Steiermark
|| 01|2017
ETHIK
men wird, selbst wenn das
erhoffte Ziel, also Heilung,
Verbesserung des Allgemein-
zustandes oder die Mög-
lichkeit ein selbstbestimmtes
Leben zu führen, dadurch
nicht mehr erreicht werden
kann?“, so Tritthart.
Viele Angehörige realisier-
ten erst am Sterbebett ihres
Partners, dass sie nach ös-
terreichischem Recht eigent-
lich keinerlei Entscheidungs-
befugnis haben. Nur eine
verschwindende Minderheit
sorge vor, etwa mittels be-
achtlicher Patientenverfügung
und Vorsorgevollmacht. Ganz
selten existiere eine derart
klare – wenn auch ungewöhn-
liche – Meinungsäußerung
wie bei jener Patientin, die
sich „Do not resuscitate“ auf
den Oberkörper hat tätowie-
ren lassen. Hier sei noch viel
Bewusstseinsbildung nötig,
betont der Vorsitzende des
Ethikkomitees.
U. JUNGMEIER-SCHOLZ
Wann verlängert eine ärzt-
liche Behandlung das Leben
und wann verlängert sie nur
noch das Sterben? Dieser Fra-
ge widmet sich das Ethikko-
mitee am LKH-Universitäts-
klinikum Graz – in grund-
sätzlichen Überlegungen,
aber auch in zahlreichen kon-
kreten Einzelfällen.
„Hilfe am Ende des Lebens,
gelegentlich auch am Anfang“
– mit diesen Worten umreißt
Hans Tritthart, Neurochirurg
und Vorsitzender des Ethik-
komitees, die Hauptaufga-
be dieser interdisziplinären
Gruppe, die vor kurzem ihr
zehnjähriges Bestehen gefei-
ert hat. Am Ende des Lebens
geht es darum zu entscheiden,
welche Form von Behandlung
noch durchgeführt wird und
welche nicht.
Am Beginn des Lebens wird
das Komitee dann kontak-
tiert, wenn ein Kind mit
multiplen gravierenden Fehl-
bildungen zur Welt kommt
– daher ist auch immer ein
Kinderfacharzt vertreten.
Manchmal bleibt da nur die
Wahlmöglichkeit, nichts zu
unternehmen, weil die Medi-
zin schlichtweg nichts Hei-
lendes anzubieten hat.
Therapieziel ändern
„Bei der Behandlung am Le-
bensende hat eine wichtige
Änderung in der Kommu-
Therapiefreiheit
bleibt beim Arzt
Worin auch immer nach sorg-
fältigem Abwägen und einge-
hender Diskussion im Konsil
das Votum des ehrenamtlich
tätigen Komitees ausfällt, es
hat keine zwingenden Rechts-
folgen. „Wir sind keine Moral-
polizei“, betont Tritthart.
Lediglich als Empfehlung sei
das Ergebnis des Konsils ge-
dacht – die Therapiefreiheit
bleibe weiterhin beim behan-
delnden Arzt oder der Ärztin,
die wie das gesamte Behand-
lungsteam auch am Konsil
teilnehmen. In den seltenen
Fällen, in denen der Patient
ansprechbar ist, gehört auch
er zumKonsil; manchmal sind
Angehörige dabei. Das Ethik-
komitee spricht abschließend
eine Empfehlung aus, prüft
aber nicht im Nachhinein, ob
der Rat befolgt wurde.
Wohl aber wird es häufig
präventiv tätig, nämlich im
nikation stattgefunden“, er-
klärt Sonja Fruhwald, Fach-
ärztin für Anästhesiologie
und Intensivmedizin sowie
stellvertretende Vorsitzende
des Ethikkomitees. „Wenn
früher von Therapieabbruch
gesprochen wurde, hat das
bei den Angehörigen große
Ängste geweckt, dass hier
plötzlich alle Maschinen ab-
geschaltet werden und ein
geliebter Mensch erstickt oder
verdurstet. Daher bezeichnen
wir unser Vorgehen nun als
Änderung des Therapieziels
– von kurativ zu palliativ –,
damit klar ist, dass der Pa-
tient weiterhin unsere volle
Aufmerksamkeit erhält und
die Linderung der Symptome
unser zentrales Augenmerk
darstellt.“
In diesen Fällen wird entwe-
der eine Behandlung nicht
mehr begonnen oder eine
bestehende wohldosiert zu-
rückgenommen – bei fort-
dauernder sorgfältiger Pflege,
angepasster Schmerztherapie
und dem Versuch, auch diese
letzte Phase so lebenswert wie
möglich zu gestalten.
Nur Minderheit sorgt vor
Im Zentrum der Diskussion
steht immer der mutmaß-
liche Wille des Patienten –
auch wenn dieser sich nicht
mehr selbst dazu äußern
kann. „Für uns lautet die
zentrale Frage: Wollte der
Patient, dass alles medizi-
nisch Machbare unternom-
Nicht Moralpolizei,
sondern Entscheidungshilfe
Vor zehn Jahren
formierte sich das Ethikkomitee am Grazer
Uniklinikum als eines der ersten in Österreich. Mittlerweile tritt
im Schnitt fast alle zehn Tage ein Konsil zusammen.
„Für uns die zentrale
Frage: Wollte
der Patient, dass
alles medizinisch
Machbare
unternommen
wird?“
Hans Tritthart
















