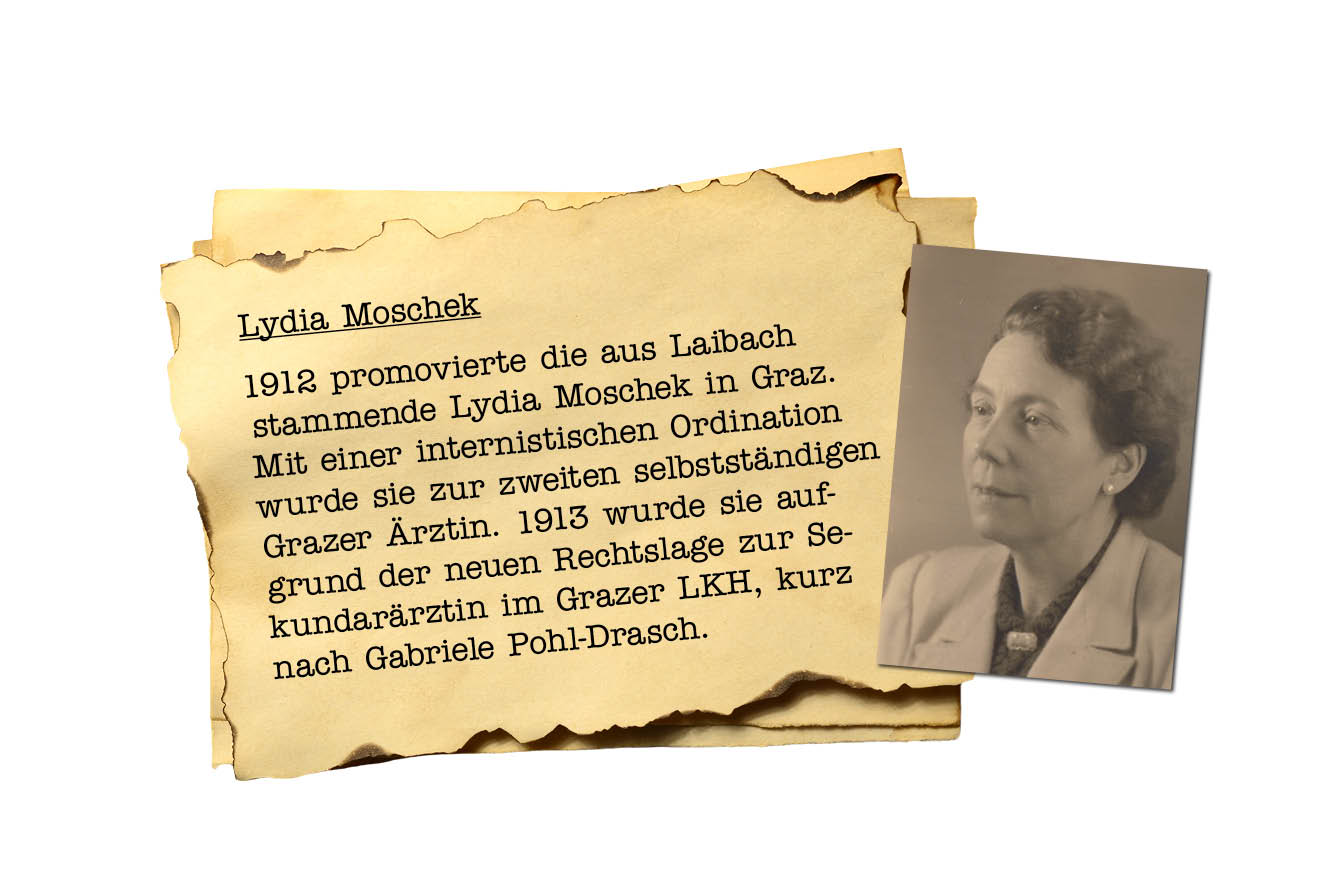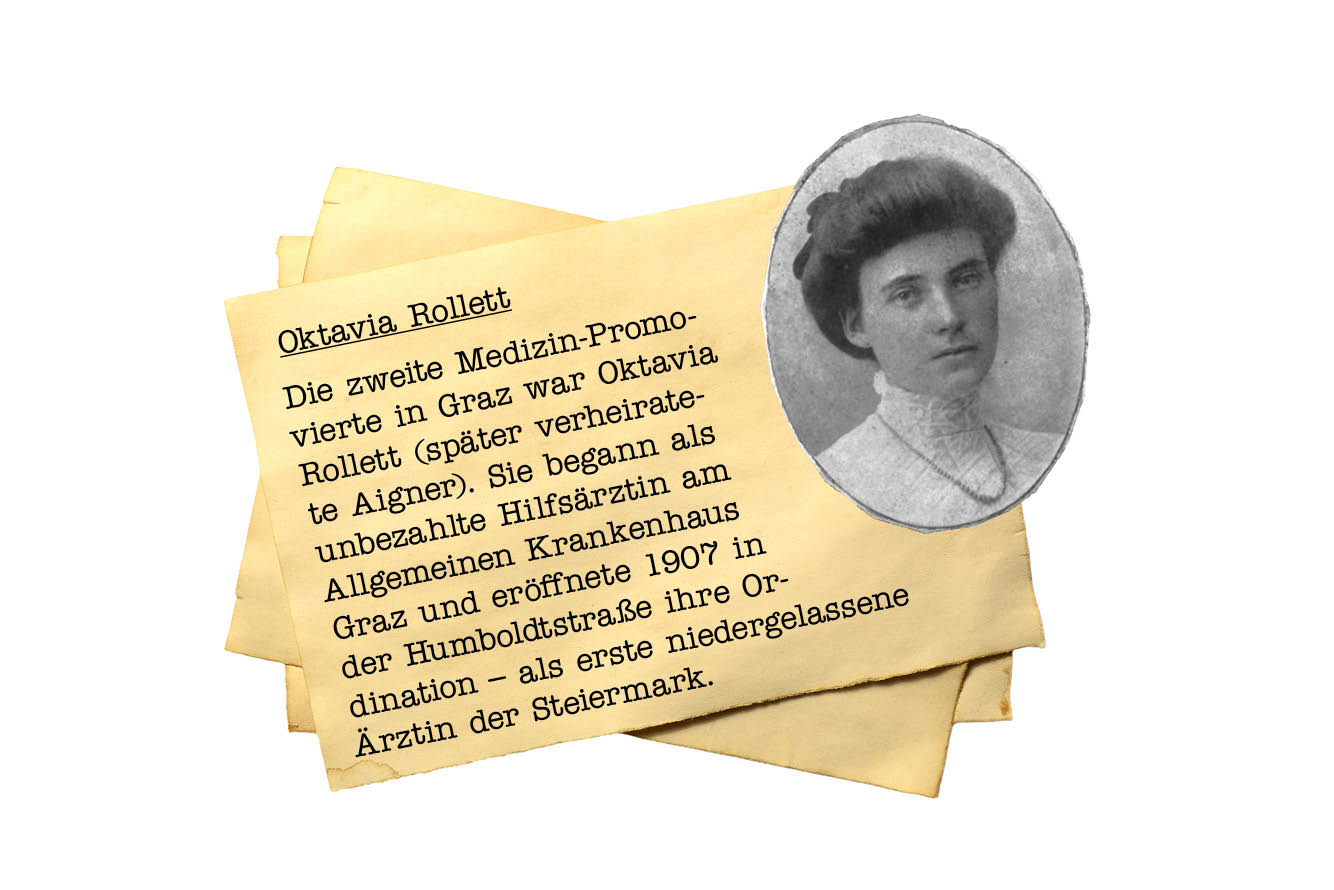AERZTE Steiermark 10/2025
Ein Wendepunkt in der Medizingeschichte
„Und bei allem war man die Erste! Die Erste, die diese oder jene Vorlesung besuchte, die Erste, die im anatomischen Seziersaal das Messer handhabt“, sagte Dora Teleky 1912 in „Neues Frauenleben“ über ihr Studium. Sie gehörte zu den ersten weiblichen Medizinstudierenden in Österreich – heute bilden Frauen die Hälfte der Ärzteschaft.
Zwischen der ersten Zulassung von Frauen für das Medizinstudium im Jahr 1900 und aktuell 3.605 Ärztinnen in der Steiermark, also 51,07 % der Ärzteschaft, liegt allerdings kein geradliniger Weg. Die Autorin Birgit Kofler-Bettschart beleuchtet in einem neuen Buch die Lebenswege der Pionierinnen, ihre Herausforderungen und Errungenschaften. Ebenso geht es darin um die Hürden, verschlossenen Türen, bürokratischen Hindernisse und gesellschaftlichen Widerstände, denen die Frauen in diesem Zusammenhang auch in vielen Jahrzehnten danach noch gegenüberstanden. Kofler-Bettschart liefert Einblicke in die Geschichte – vom Kampf der Frauen um Kassenverträge bis zu Anstellungen im Spital, von der Katastrophe der NS-Zeit bis zu den zähen Kämpfen um Gleichberechtigung in einer männlich dominierten Medizin, vom Aufbruch in den 1970er-Jahren bis zur Institutionalisierung der Geschlechtergerechtigkeit an den Universitäten.
Was war für Sie der Auslöser für das Buch?
Birgit Kofler-Bettschart: Durch das Jubiläum im heurigen Jahr habe ich mich mit dem Thema beschäftigt. Ganz grundsätzlich interessieren mich Geschichten von Pionierinnen und Vorkämpferinnen. Die Entwicklungen in der Medizin sind sinnbildhaft für die Entwicklung der Frauenrechte. Medizinerinnen waren auch bei der Frauenwahlrechtsbewegung vorne dabei. Mit dem Buch wollte ich zudem Frauen vor den Vorhang holen, die Wichtiges geleistet haben, aber vergessen wurden.
Mit der Zulassung zum Studium war es ja noch nicht getan. Was waren weitere Meilensteine?
Die Entwicklung verlief vielleicht weniger in Meilensteinen als kontinuierlich, und sie war vor allem der permanenten Hartnäckigkeit der Frauen zu verdanken. Ein roter Faden, den ich in der Recherche erlebt habe, ist, dass jedem Erfolg, den die Medizinerinnen erzielt haben, sofort die nächste verschlossene Tür, die nächste Hürde folgte. Wenn wir über spezielle Meilensteine sprechen, war hier sicher die Zulassung von Frauen zum bezahlten Spitalsdienst wichtig, denn zuerst durften sie nur unbezahlt tätig sein, ebenso die Zulassung zur Habilitation, die ersten Professorinnen. Einen Sprung gab es in den 1990er-Jahren mit den gesetzlichen Vorgaben, Positionen geschlechtersensibel zu besetzen, und später mit den Maßnahmen der positiven Diskriminierung: Bei gleicher Qualifikation mussten Frauen bevorzugt werden. Viele solcher Sprünge wurden nur durch gesetzliche Maßnahmen möglich – das ist eine zentrale Lehre.
Es gab sehr unterschiedliche Hürden zu meistern …
Ja, die ersten Frauen, die ein Studium aufnahmen, hatten es sehr schwer, weil sie unter ständiger Beobachtung standen. Man wartete geradezu darauf, dass sie scheitern, dass sie „umfallen“. Im Ersten Weltkrieg waren Frauen plötzlich gefragt, weil viele Männer im Krieg waren. Doch sobald diese zurückkehrten, mussten die Frauen ihre Plätze wieder räumen – das muss unglaublich frustrierend gewesen sein.
Wie hat sich die NS-Zeit auf die Ärztinnen ausgewirkt?
Der Nationalsozialismus hat viele Medizinerinnen besonders hart getroffen, denn unter ihnen waren viele Jüdinnen und politisch engagierte Frauen. Das hat eine dramatische Spur der Verfolgung und Vernichtung hinterlassen.
Diskriminierung fand aber auch noch viel später und findet auch heute noch statt.
Ja, davon gibt es unzählige Beispiele. Die erste ordentliche Professorin in einem chirurgischen Fach zum Beispiel: Für viele Männer brach da eine Welt zusammen. Sie haben sich einiges einfallen lassen, um solche Entwicklungen zu verhindern.
Welche Frauen haben Sie bei der Recherche besonders fasziniert?
Es ist schwer, einzelne herauszugreifen, bei so vielen spannenden Frauen. Aber eine besondere Persönlichkeit ist sicher Gabriele Possanner von Ehrenthal, die 1897 als erste Frau in der österreichisch-ungarischen Monarchie in Wien zur Doktorin der Medizin promovierte. In der Steiermark ist auf jeden Fall die Histologin Dora Boerner-Patzelt zu nennen, die erste habilitierte Medizinerin. Da war die Universität Graz vorne dabei. Oktavia Rollett ist hervorzuheben, die erste niedergelassene Ärztin in der Steiermark. Generell haben sich diese Frauen auch jenseits der Medizin stark für Frauenrechte eingesetzt, auch dafür ist Rollett ein gutes Beispiel.
„Bringen Sie mir Ihren Uterus im Glas“ – die in Ihrem Buch zitierte Aussage gegenüber einer Ärztin in einem Vorstellungsgespräch zeigt ein weiteres Thema der Diskriminierung auf.
Und da reden wir über die 1990er-Jahre. Heute ist die Sensibilität höher, man wird so schamlose Kommentare hoffentlich nicht mehr hören, aber das Thema schwingt immer noch mit. Doch wir dürfen auch nicht vergessen, was alles erreicht wurde: Heute sind 50 % der Ärzteschaft weiblich und an den 3 Med Unis in Österreich haben wir 30 % ordentliche Professorinnen. Man muss die Fortschritte sehen, aber es bleibt andererseits noch genug zu tun – Carearbeit und Kinderbetreuung bleiben Themen und hindern Frauen mehr als Männer daran, Karriere zu machen oder Vollzeit zu arbeiten. Wir haben – was die Gleichstellung betrifft – noch nicht alles erledigt!
Fotocredit: Landesarchiv, Nicholas Bettschart