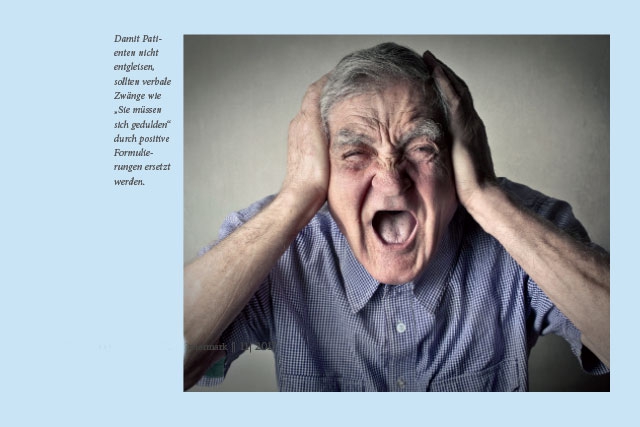Der böse Patient: Selbstschutz geht vor Patientenschutz
Noch zählt rohe Gewalt an der Klinik zu den Randphänomenen, aber das Klima wird spürbar rauer. Einige steirische Häuser schulen ihre MitarbeiterInnen vorbeugend in deeskalierender Kommunikation wie in Techniken der Selbstverteidigung.
U. Jungmeier-Scholz
Vorweg zwei gute Nachrichten. Erstens: Gewalttätige Patientinnen und Patienten sind in den steirischen Kliniken – und Ordinationen – immer noch die Ausnahme. Bei beispielsweise rund 400.000 ambulanten und 81.000 stationären Patienten des LKH-Universitätsklinikums in Graz werden jährlich nur eine Handvoll Übergriffe mit Körperverletzung gemeldet, dazu kommen ungefähr 20 Near-Miss-Fälle, also solche, in denen eine Eskalation verhindert werden konnte. Zweitens: Vonseiten des Klinikums und mittlerweile auch anderer Häuser werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon auf derartige Gefahrensituationen vorbereitet. Kommt es dennoch zu einem Übergriff, werden sie professionell nachbetreut.
Nichtsdestotrotz muss dem zunehmend raueren Klima zwischen PatientInnen, Angehörigen und dem medizinischen Personal mit klarer Zero Tolerance Policy begegnet werden. Hier trifft bei den Patienten oft eine „Ich will alles – und das sofort“-Mentalität auf Schmerz und Stress; in Kombination eine explosive Mischung. Pflegepersonal wie Ärzteschaft haben jedoch ein Anrecht auf größtmögliche Sicherheit an ihrem Arbeitsplatz. „Arbeitgeber sind verpflichtet, für Sicherheit und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer in Bezug auf alle Aspekte, die die Arbeit betreffen, zu sorgen“, heißt es dazu im Gesetz .
Betrunken, high, verprügelt
„Aggression tritt oft in Zusammenhang mit Alkohol- oder Drogenkonsum auf“, berichtet Philipp Kopp, Sicherheitsfachkraft der Abteilung Technische und Organisatorische Sicherheit am LKH-Universitätsklinikum Graz. Daher kommt es nicht selten an den Wochenenden zu Vorkommnissen – dann, wenn der Personalstand im Krankenhaus ohnehin niedriger ist. In einigen Fällen haben die Auseinandersetzungen ihren Ursprung bereits in Raufereien vor Aufnahme in die Klinik. „Teilweise werden ja die Streitparteien gemeinsam eingeliefert, gefolgt von ihren Freunden im jeweiligen Privat-Pkw, und dann geht die Auseinandersetzung in der Spitalsambulanz weiter“, erklärt Anne Rauch, Koordinatorin der Arbeitsgruppe Diversität im Gesundheitsfonds, die sich unter anderem mit Gewaltprävention an Kliniken befasst. Das Klinikum hat bereits Absprachen mit Rettungsorganisationen getroffen, sodass Verletzte eines Raufhandels in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert werden.
Missstimmungen entstehen auch dort, wo soziokulturelle Differenzen zutage treten, wenn etwa Großfamilien einen Krankenbesuch abstatten und die übrigen PatientInnen im Zimmer keine Ruhe finden. Zu einer paradoxen Situation kommt es im Bereich der Gynäkologie manchmal bei der Behandlung von Migrantinnen: Will ein Arzt eine Frau untersuchen, erheben deren Verwandte Einspruch. Übernimmt eine Kollegin den Fall, wird deren Kompetenz bezweifelt.
Eine besondere Herausforderung stellen jene Aggressionsausbrüche dar, die aus einer physischen wie psychischen Ausnahmesituation der Patienten resultieren, beispielsweise in Folge der Narkose oder als Reaktion auf eine niederschmetternde Diagnose. Mit Einsicht ist da nicht zu rechnen, Sachlichkeit auch nicht das Kommunikationsmittel der Wahl. Hier muss zunächst eine Begegnung auf emotionaler Ebene stattfinden.
Zum Melden motivieren
Als „Fall“ zählt ein Gewaltausbruch in der Statistik erst, wenn er auch gemeldet wird. „Die Anzahl der Meldungen ist allerdings nicht mit der Anzahl der Vorfälle gleichzusetzen“, betont Kopp. Vermutlich wird nur ein Bruchteil der Übergriffe bekannt gemacht – einerseits aus Scham, andererseits auch, weil das Problem bereits abteilungsintern gelöst wurde.
Ziel sei es, so Kopp, ein Klima zu schaffen, das die Meldung der Vorfälle begünstigt.
Statistisch nachvollziehen lässt sich am Klinikum die Entwicklung der letzten fünf Jahre (siehe Grafik): Pro Jahr kam es meist zu vier Fällen, in denen die Aggressoren einen Klinikmitarbeiter oder eine -mitarbeiterin verletzt haben. Parallel dazu wurden jeweils zwischen 17 und 24 Attacken registriert, die erfolgreich abgewehrt werden konnten. „Um die Meldung zu erleichtern, haben wir ein eigenes Online-Meldesystem installiert, bei dem sich der Dokumentationsaufwand in Grenzen hält“, berichtet Sicherheitsfachmann Kopp. Innerhalb von drei Tagen erhebt dann der Technische Sicherheitsdienst vor Ort die Sachlage. Durchaus erwünscht sind dabei Verbesserungsvorschläge vonseiten der Betroffenen.
Chirurgie an der Spitze
Als Hotspots der Aggression haben sich am Klinikum sechs Bereiche herauskristallisiert: die Ambulanz der Chirurgie, gefolgt von Unfallchirurgie und EBA . Danach kommen Kieferchirurgie, Gynäkologie und Gebärstation sowie die Ambulanzen von Kinderklinik und -chirurgie. Im pädiatrischen Bereich attackieren betrunkene Jugendliche das Personal, aber auch gestresste Eltern.
Lange Wartezeiten erweisen sich erfahrungsgemäß als aggressionsfördernd. „Hier kommt es zu einem Dominoeffekt: Wird ein Wartender unruhig und unfreundlich, entwickelt sich eine Dynamik, die die übrigen mitreißen kann“, erklärt Sicherheitsfachmann Kopp. Kommunikationsexpertin Christine Minixhofer empfiehlt daher, angespannt wirkenden Personen besonders empathisch zu begegnen: „Es wird leider noch ein bisschen dauern – möchten Sie inzwischen etwas trinken? Da vorne finden Sie einen Wasserspender.“ Verbale Zwänge wie „Sie müssen sich gedulden“ sollten durch positive Formulierungen ersetzt werden.
Prävention und Selbstverteidigung
Minixhofer ist Referentin jener MitarbeiterInnenschulung zum Thema „Prävention von Aggression und Gewalt im Krankenhaus“, die mittlerweile in mehreren Kliniken angeboten wird. Sie übt mit den Teilnehmern achtsame und gewaltfreie Kommunikation. Noch wird die Schulung überwiegend vom Pflegepersonal besucht, das ja an vorderster „Front“ steht – bei den Aufnahmen, aber auch am Patientenbett. Durch die geplante DFP-Approbation erhofft man sich künftig auch mehr ärztliche TeilnehmerInnen.
Über Sicherheitstechniken und rechtlichen Rahmenbedingungen informiert im Zuge dieser Veranstaltung Gernot Riedl , Jurist, Mediator und Karate-Trainer. Bewusst lehrt er die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer nur wenige Abwehrtechniken. Denn zu komplizierte Bewegungsabläufe müssten jahrelang geübt werden, um im Ernstfall verlässlich abrufbar zu sein. „In meinem Kurs geht es primär um den bewussten Einsatz körpersprachlicher Signale, aber auch um Ausweich- und Ablenkbewegungen“, erklärt Riedl. Da lernt man etwa, sich aus einem Klammergriff zu befreien, aber vor allem, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. „Erst in allerletzter Konsequenz soll es zu Körperkontakt mit dem randalierenden Patienten kommen, denn dabei ist das Verletzungsrisiko immer hoch.“
Oftmals befinden sich SpitalsmitarbeiterInnen in einem Dilemma, denn eigentlich besteht ihre Aufgabe darin, die PatientInnen zu versorgen und zu schützen und nicht abzuwehren. Darauf erwidert Riedl ganz klar: „Die eigene Gesundheit geht vor.“ Mit dem Nachsatz: „Aber es geht wirklich nur in ganz seltenen Fällen um die eigene Haut.“
Selbstbewusstsein und Selbstmitgefühl
Zahlreich sind hingegen „brenzlige“ Situationen, die in Gewalt oder sexuelle Übergriffe abzugleiten drohen. Gegen diese kann man sich bis zu einem gewissen Grad wappnen. Trainieren lässt sich sowohl das eigene Selbstbewusstsein als auch das Selbstmitgefühl. „Man darf sich in einer unangenehmen Situation ruhig selbst gut zusprechen wie einem Freund“, so Minixhofer. Auch lässt sich der Umgang mit Angst verändern und ein individuell angepasstes Stressmanagement erlernen.
Werden PatientInnen oder deren Angehörige trotz professioneller Kommunikation vonseiten des Klinikpersonals übergriffig, muss schnell Hilfe erreichbar sein. Dafür gibt es an den Hotspots des Klinikums ein Freeset mit erweiterter Funktion, von dem aus ein stiller Alarm abgesetzt werden kann. Dieser ergeht direkt an die Polizei und den Betriebsschutz. Außerhalb der Regeldienstzeit wird ein privater Sicherheitsdienst verständigt, der entweder ohnehin am Klinikum patrouilliert oder in spätestens zehn Minuten vor Ort ist. Hunderte Mitarbeitende wurden zudem mit einem Taschenalarm ausgestattet, der Angreifende im Notfall abschreckt.
Professionelle Nachsorge
Nach einem Übergriff können sich die Klinikums-MitarbeiterInnen an den internen arbeitsmedizinischen Dienst wenden, der via Krisentelefon für sofortige psychologische Betreuung sorgt. „Innerhalb einer Stunde organisieren wir eine psychologische Unterstützung“, betont Eva Klein, Leiterin des Betriebsärztlichen Dienstes . „Allerdings wurde dieses Angebot erst in weniger als zehn Fällen in Anspruch genommen.“ Wesentlich häufiger nutzen MitarbeiterInnen nach einem traumatischen Erlebnis das Angebot der externen anonymen Nachbetreuung. „Hier kann aus einem Pool von rund 50 Spezialisten gewählt werden und der Arbeitgeber übernimmt die Kosten für sechs Einheiten“, erläutert Klein.
Von Jahresbeginn bis Mitte Oktober konsultierten heuer 142 Beschäftigte die externen BeraterInnen; allerdings nur ein kleiner Teil davon aufgrund eines Gewalterlebnisses mit Patienten.
Kleinere Spitäler ziehen nach
Auch in den peripheren Häusern wird das Thema zunehmend aufgegriffen. Im LKH Feldbach-Fürstenfeld findet in Kürze eine Informationsveranstaltung statt, auf deren Basis dann Maßnahmen entwickelt werden. In Hartberg werden dem Personal bereits ähnliche Schulungsangebote gemacht wie am Klinikum. Seit einem Vorfall im vergangenen Jahr wurde dort auch das Notrufsystem optimiert. „Das Mitarbeiter-´Piepserl´ wurde mit einem speziellen Knopf ausgestattet, mit dem Tag und Nacht ein sogenannter Mitarbeiter-Alarm ausgelöst werden kann, der klar vom Herzalarm zu unterscheiden ist“, erklärt die Hartberger Pflegedirektorin Brigitte Hahn. „Ab Knopfdruck besteht dann eine direkte hausinterne Sprachverbindung zur alarmierten Personengruppe.“
Wer in Not gerät, sollte daher laut schreien und dabei gleich alle notwendigen Informationen mitliefern. Zur Hilfe gerufen werden damit diejenigen aus Ärzteschaft und Pflegepersonal, die gerade ihre Station verlassen können. „Das Notrufsystem hat sich absolut bewährt“, resümiert Hahn. Im heurigen Jahr wurde es vier oder fünf Mal genutzt, zuletzt erst vor zwei Wochen.
Sanft gerüstet
Keine Waffe, sondern vielmehr einen Schutzschirm benötigen Ärzteschaft und Pflegepersonal, wenn sie in der Klinik oder Ordination aggressiven PatientInnen gegenübertreten (müssen). Ein paar Grundregeln einzuhalten kann dabei durchaus hilfreich sein: „Einem Patienten, der angespannt oder aggressiv wirkt, begegnet man am besten in einer neutralen Körperhaltung, also etwa im Stehen Beine hüftbreit geöffnet, Knie locker, die Hände vor dem Körper und offen“, erklärt Kommunikationstrainerin Christine Minixhofer. „Auch der Gesichtsausdruck sollte neutral sein; im Konfliktfall wird Lächeln oft als Provokation aufgefasst.“ Verbale Äußerungen sollten frei von erzieherischen Elementen wie „Sie müssen“ oder „Sie dürfen nicht“ sein, vielmehr Mitgefühl ausdrücken, aber auch klare Grenzen setzen. Wichtig zu wissen: Befindet sich jemand bereits in einem emotionalen Ausnahmezustand, nutzt eine Kontaktaufnahme auf rein sachlicher Ebene nichts. Zunächst ist auf die Gefühlslage einzugehen. Am Krankenbett empfiehlt es sich, mit dem Patienten zu sprechen und möglichst keine kollegiale Parallelkommunikation unter Verwendung medizinischer Fachausdrücke zu führen.
Gernot Riedl, Jurist, Mediator und Karate-Trainer, plädiert für durchdachte Vorfeldvermeidung, etwa die Optimierung der räumlichen Gegebenheiten, Notrufsysteme, rechtliche Aufklärung – zudem für intensiven Austausch des Personals untereinander: „Wirkt ein Patient unrund, sollte das bei Dienstübergabe unbedingt kommuniziert werden.“ Außerdem empfiehlt er – nach dem Motto „Gelegenheit macht Angreifer“ – alles, was zur Waffe werden kann, sorgsam zu verwahren. „Das betrifft vor allem die chirurgischen Instrumente. Aber auch eine gläserne Mineralwasserflasche hat am Bett eines aggressiven Patienten nichts verloren.“ Ein Schreibtisch kann als Puffer zwischen Arzt und einem Randalierenden stehen, dabei ist jedoch darauf zu achten, dass man sich nicht selbst unnötig den Fluchtweg verstellt.
Fotos: Shutterstock, Hartlauer, Fotolia, beigestellt, Furgler